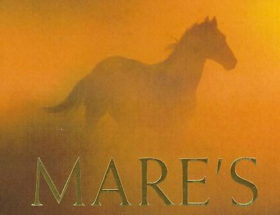Michael Scharang – Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz
Ein recht weltfremder Österreicher reist unter – wie wir alsbald erfahren – ziemlich verqueren Umständen von Wien nach New York, um dort einen kranken Hund zu hüten, während seine langjährige Liebe, die eigentlich den Hund pflegen sollte, etwas Wichtiges in Wien zu erledigen hat. Unser Held sieht alles mit ganz eigenem Blick, die Straßen sprechen zu ihm ebenso wie Ruinen oder Schiffe, die unbelebten Dinge spiegeln sein kindliches Erstaunen über die völlige Fremdartigkeit einer Stadt, die sowohl gerade gebaut wird wie auch gerade zerfällt.

Michael Scharang: Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz
In gewundenen, oft elaborierten, dennoch glasklar durchgedachten grammatikalischen Konstruktionen lässt uns Scharang teilhaben an den Erfahrungen seines Protagonisten, der noch nie einen Fernseher besaß und nun das Fernsehen voll auskostet, in der Erkenntnis, dass 60 Programme für jedermann ein Menschenrecht sein sollten, damit man wenigstens 1 Stunde am Tag minütlich zappend fernsehen könne.
Wir treffen einen Taxifahrer, der den Österreicher für einen Ägypter hält, alte Schulfreunde, und wandern in den Gedanken des Helden in dessen wahre und imaginierte Vergangenheit. Seiten füllt Scharang mit Konjunktiven, mit Hätte-Wäre-Wenn-Geschichten, ebenso viele mit geistigen Ausflügen in die Thesen von Gut und Böse, von Zerfall und Dahinscheiden, in komplizierte Diskussionen, die der Schreiber und Denker mit einer „Brotarbeit“ nicht nur für sich, sondern vor allem gegen den Koloman Spatz, den Gatten seiner Verehrten, entwickelt, sich im Vergleich, im Kontrastieren mit Spatzens Thesen erst etabliert.
Umso schräger mutet es an, dass ausgerechnet ein Spatz – die alte österreichische Familie zieht sich als roter Faden durch den Text, den ich nur mit Mühe als Roman bezeichnen mag – derjenige ist, der die Geldnot des Ich-Erzählers zu lindern vermag.
Gemeinsam erfinden die beiden eine Reality-TV-Serie über einen Detektiv, der stets vor der Lösung des Falles einem Werbeblock gleich eingeblendet wird, und verkaufen das Konzept für viel Geld an einen Sender. Dass die Musik zur Werbung bereits von Beethoven quasi vorweg erfunden wurde, erfahren wir ebenso nebenher (und wiederholt) wie die These, dass Wagner die Fernsehwerbung in Form der Oper erfunden, die Werbeeinblendungen Leitmotive genannt habe… und dass ein Schwarzer in New York sich als kannibalischer Mörder seiner Nichte ausgibt und keiner diese Medienposse, als die es sich erweist, in Frage stellt.
Die Beziehungen der einzelnen Charaktere sind ebenso gestört wie verzwickt, und so wundert es auch nicht, dass das Ganze in einem gigantischen Betrug gipfelt, der aber ebensowenig wirkliche Konsequenzen hat wie etwa das Kopulieren des Helden mit seiner Angebeteten Maria vor den Augen ihres Ehemannes. Auch das erzählt Scharang mehr beiläufig und uninteressiert, verleiht dem Akt eine blasse Beliebigkeit, pinselt über alles ein desinteressiertes sprachliches Grau.
Ich habe mich schwer getan mit diesem Roman. Zunächst lockt die sprachliche Andersartigkeit, der fremde Blickwinkel, die Absurdität der vignettenhaften kleinen Plots, die Scharang einflicht. Dann aber werden die Passagen, in denen er philosophiert, immer länger, immer ermüdender und gleichförmiger, wie ein Mantra, das langsam das Gehirn in einen Alphazustand bringt, bei dem alles nur noch zu Gemurmel und Summen wird. Die verbindende Plotlinie ist die private Geschichte des Helden mit seiner Maria, und der Familie Spatz und ihren Mitgliedern, von dort aus nimmt er seine Exkurse zu Politik, Philosophie, Gesellschafts- und Medienkritik auf, und doch ist das alles erneut beliebig, im Gegensatz zur Sprache inhaltlich nicht stringent genug aufgebaut.
Das Bedürfnis, zwingend den Argumentationen des Autors zu folgen, ihre Tiefen zu ergründen, erlahmt alsbald. Spannung kommt erst wieder im letzten Teil auf, als sich die Unternehmung – ‚Das jüngste Gericht des Michelangelo Spatz‘ – als Luftblase entpuppt und der Held das gelobte Land plötzlich fliehen muss. Und selbst diese Flucht, die atemberaubend sein könnte, bleibt farblos, fern, als distanziere sich der Autor vom Leben insgesamt. Mit den Charakteren mag ich mich weder identifizieren noch wirklich auseinandersetzen, dafür fehlt ihnen Lebendigkeit und Tiefe.
„Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz ist sprachlich hochinteressant, inhaltlich aber zu episodenhaft um wirklich fesselnd zu sein.
Bewertung: